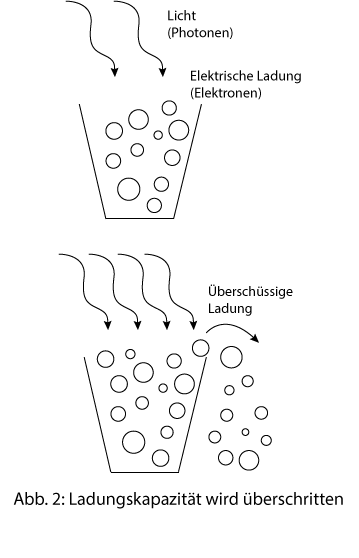Die richtige Belichtung
Wer kennt sie nicht, die alte Fotoregel? Mache niemals Aufnahmen gegen das Licht! Ansonsten können unschöne Reflexionen auf der Linse entstehen. Im schlimmsten Fall kann die Lichtquelle die Aufnahme überbelichten und unbrauchbar machen. Was der Hobbyfotograf vielleicht noch verschmerzen kann, bedeutet für den professionellen Anwender nicht selten kostspieligen Mehraufwand. Denn bei Ballistik-Tests oder in Teilen der industriellen Fertigung sind plötzlich auftauchende Lichtquellen oder lichtreflektierende Objekte die Regel. Neben Überbelichtungen (Blooming) sorgen dann auch Schmiereffekte (Smearing) für so manchen Ärger.
Eine mögliche Lösung des Problems liefert die Optik: Ein mechanischer Verschluss vor der Linse kann dafür sorgen, nur so viel Licht hindurchzulassen, wie für die Aufnahme notwendig ist. Bei der enorm hohen Aufnahmegeschwindigkeit sowie langen Laufzeiten, wie sie beispielsweise im Bereich des Machine Vision gang und gäbe ist, käme diese Methode aber schnell an ihre Grenzen. Vielversprechender ist es daher, sich auf die Architektur des Lichtsensors zu beziehen und das Problem an der Wurzel zu packen.
Ladung auf Abwegen
Lichtsensoren bestehen aus vielen lichtempfindlichen Pixeln. Sie nehmen das Licht (Photonen) auf und wandeln es in elektrische Signale (Elektronen) um. Bei einem CCD-Sensor (Charge-Coupled Device) werden die Signale zunächst in Lochpaaren gesammelt und dann über ein Schieberegister abtransportiert. Anschließend werden die gesammelten Informationen digitalisiert. Der Lichtsensor bleibt während des gesamten Prozesses lichtempfindlich (Abb. 1).
Überbelichtung (blooming) entsteht dadurch, dass die lichtempfindlichen Elemente nur eine bestimmte Ladungsmenge aufnehmen können. Wird die Ladungsmenge überschritten, wird die überschüssige Ladung an die benachbarten Einheiten übergeben. Da diese auch nur eine begrenzte Ladungsmenge aufnehmen können, kann sich der Blooming-Effekt abhängig von der Beleuchtungsstärke deutlich ausweiten (Abb. 2). Eine nahezu vollständig weiße Fläche entsteht. Schmiereffekte (smearing) hingegen tauchen auf, weil überschüssiges Licht in die Transportregister eindringen kann. Er entsteht also nach der Belichtung, wenn die Signale auf dem Weg zur Informationsauswertung sind. Im Bild verdeutlicht sich dies durch einen hellen Lichtstreifen, der sich von einer Lichtquelle ausbreitet.
Anti-Blooming und Anti-Smearing
Um Artefakte auf der Aufnahme zu verhindern, müssen ungewollte Ladungen ausgeschlossen werden. Ein erster Weg besteht darin, die Belichtungszeit zu verkürzen. Das ist allerdings nicht immer möglich. Entwickler setzen daher auf verschieden Kniffe, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Um Blooming zu verhindern, kommen so genannte Gate-Elektroden zum Einsatz. Sie werden horizontal oder vertikal neben dem Pixel verbaut und sorgen dafür, dass überschüssige Ladungen abgeleitet werden und nicht zur nächsten Einheit überspringen. Dieser Überlaufschutz nimmt jedoch wichtigen Platz auf dem Lichtsensor in Anspruch, der dann nicht mehr für lichtempfindliche Teile zur Verfügung steht. Anti-Blooming-Techniken wirken sich demnach auch auf die Bildqualität aus.
Um Smearing zu unterdrücken, sind andere Strategien notwendig. Eine bewährte Methode ist es, den Sensor in abgedunkelte Bereiche zu unterteilen, in denen das Bild ausgelesen werden kann. Prinzipiell kommen dabei zwei Methoden zur Anwendung: Bei der Interline-Transfer-Methode werden alle Pixelladungen zunächst parallel in ein angrenzendes Schieberegister verschoben. Anschließend werden sie zum Ausleseregister weitergeleitet (Abb. 3). Bei der Frame-Transfer-Methode sind die lichtempfindlichen Elemente und der Speicherbereiche in zwei Blöcke aufgeteilt. Die Ladungen werden als Ganzes in den Speicherbereich weitergeleitet und anschließend Zeile für Zeile in das Ausleseregister übernommen (Abb. 4).
Alternative zu CCD
Mithilfe der abgedunkelten Bereiche können Aufnahme und Auslese der Bildinformationen beinah parallel stattfinden, was sich besonders bei Highspeed-Aufnahmen als Vorteil erweist. Der Nachteil ist identisch wie beim Anti-Blooming: Ein nicht zu unterschätzender Anteil der lichtempfindlichen Bereiche des Pixels muss für diese abgedunkelten Bereiche geopfert werden. Besonders bei der Frame-Transfer-Methode wird sehr viel Platz beansprucht. Der Füllfaktor reduziert sich, die Lichtempfindlichkeit lässt nach. Um dem entgegenzuwirken, haben viele Entwickler Mikrolinsen vor die lichtempfindlichen Teile gesetzt. Diese Lens-on-Chip-Technik kann aber den Verlust nicht völlig ausgleichen.
Eine andere Möglichkeit, lästige Artefakte zu minimieren liegt in der Wahl eines anderen Chipdesigns. CMOS-Sensoren (Complementary Metal Oxide Semiconductor) zeichnen sich dadurch aus, dass die Ladung nicht zeilenweise verschoben werden muss. Stattdessen sorgt eine Transistor an jedem Pixel dafür, dass die Ladung unmittelbar in eine Spannung umgewandelt wird. Die Transistoren schirmen das Licht ab. Doch auch hier besteht das Problem, dass wertvolle Fläche für lichtempfindliche Teile wegfällt und die Füllrate leidet. Die meisten CMOS-Chips verfügen daher ebenso über Mikrolinsen. Dennoch kann mittels CMOS die Auslesegeschwindigkeit nochmals deutlich gesteigert werden. Für Anwendungen im Bereich der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen kommt CMOS-Chips daher eine wichtige Bedeutung zu.
Das Verhältnis von Belichtungszeit und Auslesegeschwindigkeit ist maßgeblich verantwortlich für die Entstehung störender Elemente wie Smearing oder Blooming. Bleibt die Beleuchtung konstant, hilft eine Erhöhung der Auslesegeschwindigkeit. CMOS-Chips haben aufgrund ihrer Architektur hier einen signifikanten Vorteil. Je höher die Auslesegeschwindigkeit, desto weniger überflüssige Ladungen können entstehen.
viZaar - Ihr Ansprechpartner für... Visuelle Prüfung Thermografie Highspeed
Die viZaar industrial imaging AG ist Profi in den verschiedenen Bereichen der visuellen Prüfung. Ob im VT Bereich oder in der Welt der Thermografie oder des Highspeed – wir sind Ihr Ansprechpartner. Folgende Dienste bieten wir Ihnen zum Thema Highspeed an: